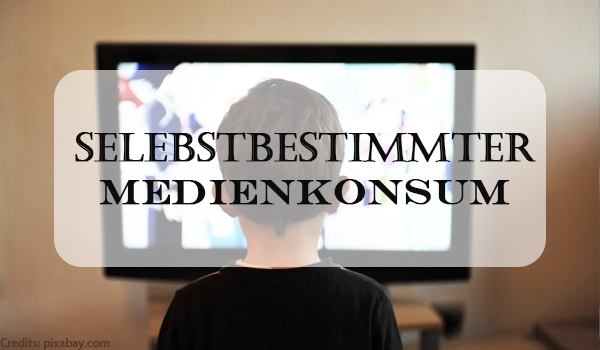
Beim Thema selbstbestimmter Medienkonsum, scheiden sich die Geister.
Bis heute fragte ich mich immer: “Warum nur?” Mir war das tatsächlich nicht klar – heute verstand ich es endlich.
Der Grund ist die unterschiedliche Auffassung des Wortes “Selbstbestimmung”.
Dabei ist es eigentlich ganz einfach und ich werde in diesem Artikel versuchen, was selbstbestimmter Medienkonsum (Selbstregulation in puncto Medienkonsum) für mich bedeutet.
Darüber was Selbstbestimmung ganz allgemein bedeutet, habe ich in meinem anderen Artikel schon geschrieben,. Heute beziehen wir uns auf den Medienkonsum unserer Kinder.
Was ist Selbstregulation?
Dazu fangen wir mit dem Begriff an: Selbstregulation aus der psychologischen Sicht, setzt die Fähigkeit voraus, z. B. Handlungen oder Impulse bewusst oder unbewusst zu steuern.
Angeborene und erworbene Fähigkeiten der Selbstregulation
Für mich sagt das schon alles: Es setzt Fähigkeit voraus.
Angeborene oder erworbene Fähigkeiten sind dabei der Unterschied. Die Selbstregulation z. B. in puncto essen und schlafen, gehört zu den angeborenen Fähigkeiten, wohingegen der Medienkonsum zu den erworbenen zählt.
Gesunde Kinder essen, wenn sie Hunger haben. Sie nehmen sich in der Regel was und wie viel sie brauchen. Auch schlafen sie einfach ein, wenn sie müde sind und wachen auf, wenn sie ausgeschlafen sind. Diesem natürlichen Rhythmus muss man nicht unterbrechen oder ändern. Darüber sind sich fast alle einig. Sicher gibt es Kinder, die sich auch im Schlafverhalten nicht selbst regulieren können, dies hat aber zumeist tiefergehende Ursachen.
Beim Thema Medienkonsum sind sich dann viele uneinig. Es heißt dann, da funktioniere eine Selbstregulation nicht.
Klar ist, wenn wir nach der oben angeführten Definition gehen, dass es der Fähigkeit bedarf, Handlungen bewusst oder unbewusst zu steuern. Diese Fähigkeit besitzt ein kleines Kind in der Regel natürlich nicht (aber auch hier gibt es Ausnahmen).
Das Tablet, das Handy, der Fernseher – all das ist viel zu interessant um einmal hin zuschauen, oder damit zu spielen und es dann wieder abzulegen und ihm kaum noch Beachtung zu schenken.
Selbstregulation vs. Fremdregulation
Unser elterlicher Instinkt sagt uns, dies oder das müssen wir verbieten oder zumindest regulieren, schließlich wollen wir unseren Kindern nicht schaden. Hierbei stellt sich für mich dann aber die Frage: “Muss ich es regulieren, oder gibt es eine Alternative für uns?”
Die Fremdregulation (also wir regulieren FÜR unsere Kinder den Medienkonsum ohne Diskussion) fühlt sich auf den ersten Blick tatsächlich richtig und gut an. Wir haben es in der Hand. Die Kleinen sind ja gar nicht in der Lage sich selbst zu regulieren und die Konsequenzen abzuschätzen (was augenscheinlich stimmt, da es sich hierbei ja um eine erworbene Fähigkeit der Regulation handelt) – also geben wir ihnen nicht die Chance, es zu “lernen”. Die Fremdregulation schiebt die Selbstregulation aber nur auf – ob das sinnvoll ist oder nicht, muss jede Familie für sich entscheiden, sowie das für und wider abwägen.
Selbstregulation in Bezug auf den Medienkonsum bei (Klein)Kindern sieht für mich wie folgt aus:
Wir leiten unsere Kinder an, sich selbst zu spüren. Wir begleiten unsere Kinder. Wir lassen sie in ihrem Tun niemals alleine. Wir strafen nicht, wir lügen nicht und greifen nur bedingt ein, nämlich dann, wenn es um den Schutz geht. Wobei sich hier immer wieder die Frage stellen muss: “Ab wann ist Schutz wirklich ein Schutz für unsere Kinder und wo ist es eher ein Selbstschutz?”
Sich selbst zu spüren ist dabei essenziell. Warum? Weil wir uns selbst spüren müssen, um unsere Kinder zu spüren. Wir müssen unsere Gefühle, das negativ behaftete Bild des Handys/ Tablets/ Fernsehers, außen vor lassen, sonst übertragen wir unsere Gefühle auf die des Kindes und verlieren so den unvoreingenommen Blick. Kinder haben extrem feine Antennen und fühlen mehr als wir, sie können sich nicht spüren, wenn wir mit uns nicht im Reinen sind, unsere Gefühle sind ihre. Erst in der fortgeschrittenen Autonomiephase fangen sie an dies zu durchbrechen.
Wir begleiten unsere Kinder – liebevoll – und lassen sie in ihrem Tun niemals alleine. Wir bewerten ihr Tun nicht und geben ihnen Raum, geschützten Raum. Wir lassen sie nicht blindlinks alles aussuchen und dann anschauen, ohne selbst einen Blick darauf zu haben. Das wäre mehr als fahrlässig. Auch lassen wir ihnen keinen unkontrollierten Zugriff, was heißt, z. B. Fernbedienungen außer Reichweite zu legen. Und natürlich, weil wir eben unser Kind eng begleiten, nehmen wir es wahr: Wenn es also anfängt aufzustehen und umher zu laufen, etwas anderes spielt, oder malt und bastelt, gehen wir darauf ein und schalten den Fernseher aus. Wir nehmen seine Signale eher wahr, als es das selbst bewusst tut. Das Kind folgt seinen Impulsen. Seine Signale sollten wir ihm gegenüber verbalisieren.
Strafen oder Konsequenzen sind absolut fehl am Platz. Ein “Der Fernseher ist kaputt.” oder “Der Akku vom Tablet ist leer.” – obwohl es nicht stimmt – ist eher kontraproduktiv. Es verschafft uns zwar für einen kurzen Moment Luft, wirkt sich aber 1. nachteilig auf unsere Eltern-Kind-Beziehung aus und 2. wirkt es, wie schon erwähnt, nur kurzzeitig. Irgendwann kommen die Kinder dahinter, das der Fernseher nicht kaputt ist und der Akku vom Tablet nicht dauerhaft leer sein kann.
Praktisch sieht der selbstbestimmte Medienkonsum im Alltag also so aus:
1. Niemals alleine
2. Dem Alter entsprechend
3. Keine Selbstaufgabe und einschränken der eigenen Selbstbestimmung
4. Körperliche und geistige Unversehrtheit steht über der Selbstbestimmung
5. Alternativen bieten
Was bedeutet das im Einzelnen?
1. Niemals alleine
Das Kind braucht dem Alter entsprechende Begleitung. Es wird nicht vor dem TV-Gerät geparkt. Der TV ist kein Babysitter. Medien sollten möglichst aktiv genutzt werden und nicht als passiver Zeitvertreib. Es ist nichts dagegen einzuwenden sich auch einfach mal berieseln zu lassen, aber Kommunikation und Interaktion ist während der Mediennutzung ein guter Ausgleich, fördert die Sprachentwicklung und stärkt die Konzentrationsfähigkeit. Wichtig ist, dass wir gegen die negativen Auswirkungen des Medienkonsums arbeiten und nicht den Medienkonsum per se als potenzielles Risiko betrachten. Eltern entscheiden, wie sie die Begleitung gestalten und was für sie vertretbar ist. Begleitung eines Zweijährigen ist anders als die Begleitung eines Zwölfjährigen.
2. Dem Alter entsprechend
Dabei geht es nicht um die FSK, sondern um die tatsächliche Reife des Kindes. Jeder kennt sein Kind am besten. Daher ist es an uns, aufmerksam zu sein. Nur weil ein Film/ eine Serie FSK 0 ist, heißt das nicht, dass sie für unser Kind passt. Unabhängig davon, dass wir unser Kind kennen, sollten wir Filme immer erst alleine schauen. Zudem ist auch hier wieder deutlich zu erkennen, wie wichtig die enge Begleitung ist. Wenn wir meinen, unser Kind ist bereit für diesen Film, wir aber im Verlauf merken, dass es unserem Kind nicht guttut, liegt es an uns, im Interesse des Kindes eine Alternative zu bieten und den Film zu beenden. Frust seitens der Kinder sollte ausgehalten und angenommen werden.
3. Keine Selbstaufgabe und einschränken der eigenen Selbstbestimmung
Ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen uns nicht selbst aufgeben. Termine sind Termine. Müssen wir diese wahrnehmen, steht auch das über der Selbstbestimmungsmöglichkeit unseres Kindes. Das wäre eine Grenze die besagt: „Hier hört deine Selbstbestimmung auf, da der Ausfall des Termins eine für dich nicht einschätzbare Konsequenz hat.“ Arzt-Termine, Einkäufe, Behörden, Kochen usw. – sofern (!!) eine Begleitung des Medienkonsums nicht sichergestellt werden kann – heißt: Könnte ich während des Kochens theoretisch begleiten, nutze dies aber als Ausrede, um den Medienkonsum zu unterbinden, wäre es Regulation und würde aktiv in das Selbstbestimmungsrecht des Kindes eingreifen. Biete ich ihm aber die Alternative, mir zu helfen oder zu spielen und das Kind nimmt diese Alternative an, wäre ein kein Eingriff.
4. Körperliche und geistige Unversehrtheit steht über der Selbstbestimmung
Auch hier gilt: Wir sind für das Wohl des Kindes und unser eigenes verantwortlich. Sollten wir erkennen, dass unser Kind unter dem Medienkonsum leidet, müssen wir einschreiten. Das heißt nicht, dass wir den Medienkonsum stark reglementieren müssen, sondern uns langsam ran tasten und enger begleiten und achtsamer auswählen. Und auch hier gilt: Es geht um wirkliches leiden und keine “es könnte ja sein, dass …”. Eingreifen zum Schutz ist wichtig und richtig, sollte aber auch hier wieder nicht ein Vorwand sein, mit dem wir uns herausreden, um den Medienkonsum zu regulieren.
5. Alternativen bieten:
Wie bereits erwähnt, können wir jederzeit Alternativen bieten, wenn wir Ängste entwickeln, aber keinen wirklichen Grund haben hier stark zu regulieren. Je authentischer wir sind, desto einfacher ist es für das Kind. Bieten wir also lieber gute Alternativen zu den Medien, anstelle die Medien zu verbieten/ zu regulieren. Halten wir es aber auch aus, wenn das Kind die Alternativen aktuell ablehnt. Es ist sein Recht.
Zusammengefasst:
Selbstbestimmung sollte mit dem Familienleben vereinbar sein. Verpflichtungen haben Vorrang. Wir sollten Verpflichtungen aber nicht als Ausrede benutzen oder willkürlich welche erschaffen, nur um dem Kind so wenig wie möglich Zeit für den Medienkonsum zu lassen. Jede Familie hat andere Gegebenheiten und Voraussetzungen, daher ist es unerlässlich für jede einzelne genau zu prüfen, welcher Rahmen für sie der passende ist.
Wir sehen, Selbstbestimmung ist komplex und wir sollten es vermeiden, uns an dem Wort Selbstbestimmung hochzuziehen. Selbstbestimmter Medienkonsum hat rein gar nichts damit zu tun, Kinder einfach uneingeschränkt Zutritt zum TV zu geben, sondern vielmehr damit, achtsam auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kinder zu achten, sie zu begleiten und keine willkürlichen Grenzen zu schaffen.
Vertrauen wir darauf und vor allem, geben wir ihnen die Möglichkeit, ihre Grenzen spüren zu lernen.
Was machen wir aber, wenn wir unsere Ängste nicht überwinden können?
Bei allem Für und Wider des selbstbestimmten Medienkonsums, eins sollten wir bei alldem wissen: Ist unsere Angst so groß, dass wir unsere Kinder nicht selbstbestimmt entscheiden lassen wollen, sollten wir dies auch nicht tun. Es kommt stark auf unsere innere Haltung an. Strahlen wir nicht aus, was wir unseren Kindern ermöglichen wollen, werden immer wieder neue Konflikte entstehen und wir werden uns immer unwohler fühlen. Das überträgt sich auf unsere Kinder und sorgt für zusätzliche Anspannungen.
Selbstbestimmter Medienkonsum sollte niemals an Erwartungen oder Bedingungen geknüpft sein. Wenn wir auf den Tag X warten, an dem das Kind den TV ausschaltet, zu einem Zeitpunkt, der uns genau richtig erscheint, ist das eine Erwartung. Diese Erwartung wird unser Kind u. U. nie erfüllen.
Seien wir ehrlich zu uns selbst, akzeptieren wir unsere Ängste. Versuchen wir sie aufzuarbeiten und alte Glaubenssätze abzulegen. Lesen wir Studien, aber nicht einseitig und nur das was uns in unserer Meinung bestärkt, sondern lesen wir auch Gegenstudien und wägen dann genauestens ab. Stehen wir zu unserer Entscheidung und tragen wir die Konsequenzen in vollem Bewusstsein.
